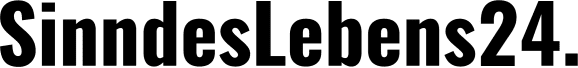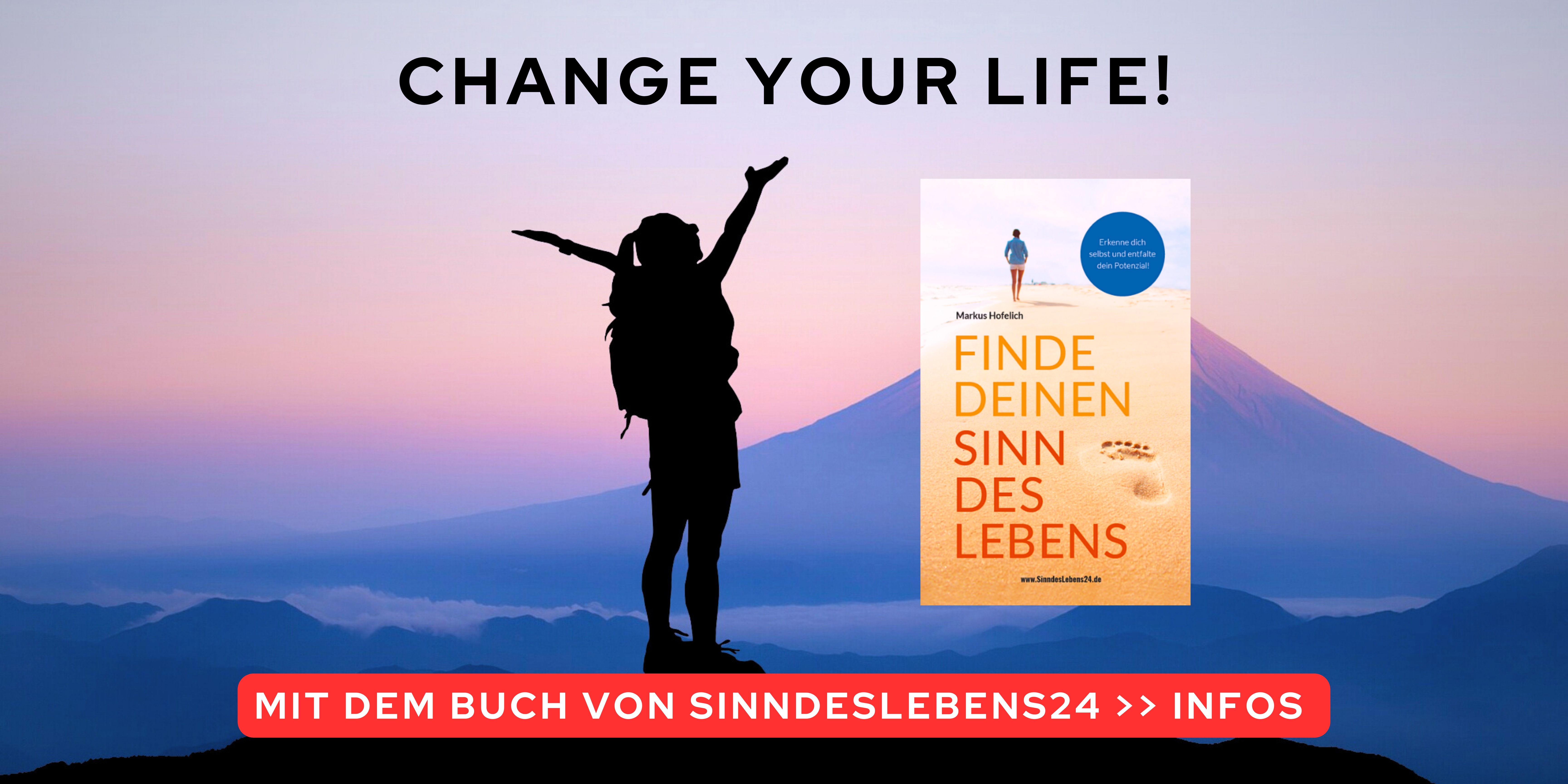Der Querdenker, Sinnsucher, Rebell und Lebenskünstler Konstantin Wecker zählt zu den großen deutschen Liedermachern. Neben seinem kreativen Schaffen als Musiker, Komponist, Poet, Schauspieler und Autor setzt sich das „Kraftgenie“ bis heute unermüdlich aktiv für Zivilcourage, Pazifismus und Antifaschismus ein. In seinem wild-bewegten, „uferlosen“ Leben mit extremen Höhen und Tiefen – die er in seinen inspirierenden Büchern schonungslos offen beschreibt – hat die Suche nach Sinn und Spiritualität immer eine wichtige Rolle gespielt. Im Interview spricht Konstantin Wecker über sein Verständnis von Gott und Spiritualität, sein soziales Engagement, die Kunst des Scheiterns und darüber, wie viel Mönch und Krieger in ihm stecken.
Herr Wecker, Sie sind dieses Jahr am 1. Juni 70 Jahre alt geworden. Trotzdem arbeiten Sie voller Energie an zahlreichen Projekten und absolvieren gerade ein straffes Tour-Programm. Wie schaffen Sie das? Was treibt Sie an?

Fotograf: Bayerischer Rundfunk/Wilschewski
Wecker: Ich bekomme die Energie vor allem durch meine Konzerte. Viele Leute glauben, Energie sei etwas, das man als Grundpaket bei der Geburt mitbekommt und das von Jahr zu Jahr immer weniger wird. Das stimmt natürlich nicht. Energie ist da und man muss nur die Offenheit haben, sie anzapfen zu können. Je offener man ist, desto mehr Energie kann man sich holen – das ist im Alter genauso wie in der Jugend. Viele werden im Alter jedoch immer verschlossener und deswegen auch unenergetischer.
Ich hatte das große Glück, mit meinem Freund Dieter Hildebrand – dem begnadeten Kabarettisten, Schauspieler und Autor – noch bis kurz vor seinem Tod 2013 einen intensiven Austausch zu pflegen. Es war unglaublich, wie er noch mit 86 Jahren nur so gesprudelt hat vor Energie. Es lag auch daran, dass Dieter ein für Alles offener Mensch war, der sich nie verschlossen hat und auch nie ein endgültiges und abgeschlossenes Weltbild hatte.
Gerade zur Zeit erlebe ich sehr intensiv, wie mein Publikum mir die gleiche Ermutigung zurückgibt, die ich ihm – Gott sei Dank – geben kann. In meinen Konzerten sehe ich Tausende Menschen, die die gleichen Hoffnungen haben wie ich, die nicht immer einer Meinung mit mir sind, aber die gleichen Sehnsüchte mit mir teilen. Das gibt mir eine Kraft, die ich nicht hätte, wenn ich die ganze Zeit nur alleine für mich in einer stillen Ecke schreiben würde – da würde ich vielleicht zum Zyniker werden.
In den letzten zwei Jahren merke ich viel mehr noch als früher, was Kunst wirklich vermag. Kunst kann ermutigen und dadurch kann sie natürlich auch etwas verändern. Gottfried Benn sagte so schön „sich selbst begegnen im Gedicht“. Er meinte damit, dass sich nicht nur der Dichter, sondern auch der Leser im Gedicht selbst begegnet. Das stößt Veränderungen an. Immer wenn ich Dostojewski gelesen habe, wurde ich für einige Wochen zu einem besseren Menschen, es veränderte etwas in mir. Und genauso bekomme ich eine Kraft durch mein Publikum.
Sie sind Liedermacher und Poet, gleichzeitig sind sie sozial sehr engagiert und befassen sich intensiv mit Spiritualität. Wie passen diese Themen zusammen, wie befruchten sie sich gegenseitig?
Wecker: Ich habe das alles nie als so getrennt betrachtet, für mich war das immer ein großer Zusammenhang. Dahinter steckt kein ausgeklügelter, durchdachter Master-Plan, das hat sich alles in meinem Leben aus sich heraus ergeben. Mein Engagement für Zivilcourage, Pazifismus und Antifaschismus ist aus Dingen entstanden, die mich innerlich schon immer stark beschäftigt haben. Das spiegelt sich natürlich auch in meinen Liedern, Gedichten und Büchern wider. Und Kreativität und Spiritualität hängen für mich untrennbar zusammen.
In erster Linie sehe ich mich als Poet. Ich bin zwar von Kindheit an mit der Musik groß geworden und wollte auch als Kind Opern-Komponist werden. Aber als ich mit 12 Jahren angefangen habe, Gedichte zu schreiben, merkte ich, dass das eigentlich der Hauptpunkt meiner Kreativität ist.
Wo sehen Sie die Haupt-Quelle Ihrer Kreativität? Was hat diese unbändige Schaffenskraft mit Spiritualität zu tun?
Wecker: Die Quelle der Kreativität sehe ich auf jeden Fall nicht in der Ratio. Das resultiert aus der Tatsache, dass ich beim Schreiben von Liedern und Gedichten zu 90 % nicht denke. Sicher denke ich vorher über die Dinge nach, die mich beschäftigen. Manchmal denkt man ja viel zu viel über etwas nach, dann jagen einen sinnlose Gedanken. Es ist schrecklich, wenn einen die Ratio so im Griff hat, dass man aus irgendwelchen Denkmustern gar nicht mehr herauskommt.
Doch wenn ich ein Gedicht oder ein Lied schreibe, dann passiert mir das, es geschieht einfach. Das ist nicht etwas Erarbeitetes, sondern ein Geschenk. Es passiert mir, dass ich mich für eine gewisse Zeit in eine Sphäre versenke, die ich nicht erklären kann: In einem Raum zu sein, wo einem Musik und Worte geschenkt werden. Daher kommt wahrscheinlich auch meine Sehnsucht nach Spiritualität, denn dieser kreative Prozess ist ja eigentlich eine spirituelle Erfahrung.

Fotograf: Thomas Karsten
Dieser Zustand lässt sich auch nicht erzwingen oder künstlich herbeiführen. Immer wenn ich aktiv versucht habe, mich in diesen Zustand zu bringen, hat es nicht funktioniert. Vielleicht waren anfangs meine Drogenexperimente auch so ein Versuch, künstliche Paradiese zu erschaffen – wie Charles Beaudelaire so schön sagt – und sich mit irgendwelchen Mitteln in diesen Zustand zu begeben. Aber das hat nicht geklappt, dabei kam nichts heraus.
Dieses kreative Talent ist einfach eine Glückssache. Das war mir schon als sehr junger Mann klar, dass ich nichts dafür kann – auch wenn man da etwas eitler ist und gerne stolz auf etwas wäre, das man sich erarbeitet hat. Dieser heilige Moment, um es gerne so pathetisch auszudrücken, ist nicht planbar, sondern er passiert einem einfach. Das macht auch deutlich, dass es unendlich viel gibt, was man mit der Ratio nicht erfassen, nicht erschließen und nicht erklären kann. Da wird man von Anfang an, ohne das Wort missbrauchen zu wollen, demütig.
Ich habe dafür ein poetisches Bild für mich gefunden: Ich habe das Gefühl, es gibt eine Quelle, in der Rilke täglich badet, Mozart täglich seine Späße macht, und an der die großen Meister lagern. Und ich darf ab und zu aus dieser Quelle trinken. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Wozu wollen Sie die Menschen durch Ihr Schaffen, Ihre Lieder, Ihre Bücher und Ihr politisches Engagement anregen? Was ist Ihre wichtigste Botschaft?
Wecker: Interessanterweise hatte ich nie eine Botschaft. Wenn ich etwas geschrieben habe, dann wurde von anderen eine Botschaft herausgelesen. Mein Antrieb war es nie, gezielt darüber nachzudenken, wie ich eine Botschaft über meine Lieder und Gedichte transportieren kann. Das sind alles Dinge, die mich tief beschäftigen und dann plötzlich als Lied oder Gedicht ihren Weg nach Außen finden. Das geht nicht auf Kommando.
Hier ein Beispiel. In den 1980er Jahren bin öfter in der Kabarett-Sendung „Scheibenwischer“ in der ARD aufgetreten. Da kam der Regisseur Samy Drechsel regelmäßig auf mich zu und sagte: „Du bist im nächsten Scheibenwischer wieder dran, wir haben folgendes Thema und ich brauche ein Lied dazu“. Da habe ich ihm immer wieder gesagt: „Samy, das geht nicht. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich will jetzt zu diesem Thema ein Lied schreiben. Mir müssen die Lieder passieren und dann ist das Thema da.“
Eine der ganz wenigen Ausnahmen – dass ich bewusst eine Botschaft in ein Lied gepackt habe – war mein Lied „Ich sage nein“, das ich 1991 geschrieben habe, als die ersten Ausländerheime in Deutschland brannten. Es ist ein wichtiges Lied, aber nicht gerade poetisch herausragend. Ansonsten ergab sich die Botschaft immer aus dem Lied.
Nehmen wir das Lied „Willy“, das mich auch bekannt gemacht hat. Es erschien 1977 auf meiner Platte „Genug ist nicht genug“, mit der ich letztendlich auch den Durchbruch geschafft hatte. Darin ging es um meinen Freund Willy, der von Rechtsradikalen erschlagen worden war. Ich weiß noch genau, wie ich es ganz spontan bei einer Bandprobe geschrieben habe.
Schon wochenlang hatte ich die Zeile „Gestern habns an Willy daschlogn“ im Kopf. In einer Pause ging ich in den Nebenraum, da stand ein altes Klavier. Nach 20 Minuten kam ich zurück und sagte den Musikern „mir ist da gerade was eingefallen, ich weiß nicht, ob das nicht viel zu privat ist“ und spielte es ihnen vor. Ich merkte an ihren Reaktionen, dass es sie berührt hat.
Da hatte ich auch nicht vor, eine Botschaft hineinzupacken – die Geschichte ist mir einfach so herausgerutscht. Und so ist es mit fast allen Liedern und Gedichten gewesen. Bei meinen Büchern war es natürlich etwas anderes. Wenn man Prosa schreibt, ist das Denken sicher mehr dabei, als bei der Lyrik.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Kirche, Glauben und Gott?
Wecker: Ich bin zwar katholisch aufgewachsen, wurde aber nie von meinen Eltern in die Kirche getrieben. Mein Vater war ein Freigeist, meine Mutter katholisch angehaucht. Mit der katholischen Kirche habe ich eher negative Erfahrungen gemacht. Vor allem durch meine Religionslehrer in der Volksschulzeit, da herrschte immer noch ein alter Nazi-Geist vor. Mir wurde im Religionsunterricht immer vom „lieben Gott“ erzählt.
Doch dieser liebe Gott war unglaublich streng, blickte jeden Tag unter die Bettdecke und sah immer genau hin, ob man auch brav betet. Das war mir unangenehm und ich dachte, mein Vater ist so viel besser, als der liebe Gott – denn ich hatte das Glück, in der Geborgenheit eines sehr liebevollen Elternhauses aufzuwachsen. Ich habe lang gebraucht, um mich von all dem zu befreien, was man mir kirchlich auferlegt hatte.
Wenn wir von Gott sprechen, müssen wir uns immer bewusst sein, dass Worte Symbole sind, und dass sie nicht zu Ende interpretiert werden dürfen, von niemandem. Und dass wir die Interpretationshoheit darüber auch nicht irgendwelchen Herrschenden überlassen sollten. Das Wort „Gott“ ist ein wunderbares Symbol. Ich habe es für mich von allen Dogmen befreit.

Fotograf: Annik Wecker
Aber ich kann auch gut verstehen, wenn andere Leute Probleme damit haben und deswegen bin ich auch vorsichtig, dieses Wort in öffentlichen Diskussionen zu verwenden. Da gilt für mich das Credo des indischen Philosophen Jiddu Krischnamurti: „Allein schon zu sagen ich bin Hindu oder Christ, ist eine Kriegserklärung“.
Mein geliebter Lyriker Rainer Maria Rilke hat als junger Mann sehr mit Gott und dem Katholizismus gehadert und sich in seinen Gedichten intensiv damit auseinandergesetzt. Mit dem Gott Rilkes hatte ich nie ein Problem. Mir war klar, dass die Hinwendung Rilkes zu Gott, dessen Interpretation von Gott, etwas ganz anderes ist, als das Wort „Gott“ aus dem Mund eines katholischen Priesters.
Ich habe auch ein Problem mit dem Wort Glauben. Ich sehe mich eher als Mystiker, und der Mystiker will nicht an etwas glauben, sondern er will etwas erfahren. Ich will auch nicht, dass mir ein Priester oder Lehrer Gott vermittelt, sondern ich möchte, dass Gott in mir selbst spricht. Deswegen würde ich auch nicht sagen, ich glaube an Gott. Ich habe aber bereits öfter erfahren, dass es dieses Göttliche gibt – wie auch immer man es bezeichnen mag. Das ist vielleicht auch die Quelle, von der wir vorher gesprochen haben.
Wie ist Ihr Engagement für Zivilcourage, Pazifismus und Antifaschismus entstanden?
Wecker: Mein pazifistisches Engagement hat sehr viel mit meinen großartigen Eltern zu tun. Sie waren Antifaschisten, das war ein großer Glücksfall für mich. Ich konnte schon als kleiner Junge mit ihnen über die Hitler-Zeit und den Nationalsozialismus reden, bei den meisten Schulkamerdaden wurde dieses Thema Zuhause aus Scham totgeschwiegen. Wenn überhaupt, dann wurden in der Nachkriegszeit hinter vorgehaltener Hand Kriegsabenteuer erzählt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Aber mit meinen Eltern konnte ich wirklich über alles reden. Meine Mama hat mir erzählt, wie sie in der Münchener Innenstadt immer durch die „Drückebergergasse“ gegangen ist – wie die kleine Viscardigasse damals im Volksmund hieß – um nicht an der zum Nazi-Mahnmal erklärten Feldherrnhalle den Arm zum Hitlergruß heben zu müssen. Durch die kleine Gasse gingen alle, die keine Nazis waren. Mein Vater hat sogar den Kriegsdienst im Zweiten Weltkrieg verweigert und trotz allem überlebt. Er war so mutig, wie ich es nie sein musste in meinem Leben. Das hat mich sehr geprägt.
Sie sind bis heute bekennender Anarchist. Was genau meinen Sie damit, welche Gedanken stecken dahinter?
Wecker: Die Anarchie wird immer als Schreckgespenst gesehen. Aber Anarchie heißt nichts anderes, als dass man keinen Herrscher über sich haben will. Ich bin der Meinung, dass kein Mensch das Recht dazu hat, einem anderen einen Befehl zu erteilen. Das Extrembeispiel Militär macht es deutlich: Dort passiert es, dass man entmenschlicht wird wie eine Maschine und einem das Herz aus dem Leib gerissen wird. Das ist für mich absolut der falsche Weg. Wir können miteinander reden, wir können etwas einsehen, wenn der andere vernünftige Argumente hat – aber das sind keine Befehle, das ist etwas, das man sich gemeinschaftlich erarbeitet. Ich habe neulich einen Satz vom Dalai Lama gelesen, der so eindeutig ist:
Der Mensch ist im Grunde genommen ein empathisches Wesen.
Dalai Lama
Auch wenn viele Gesellschaftsformen versuchen, ihm das immer wieder auszureden. Zum gleichen Ergebnis kommt der große jüdische Psychologe Arno Gruen in seinen Forschungen über matriarchale und indigene Gesellschaften. Er sagt:
Der Mensch ist ein empathisches Wesen, wenn es ihm nicht ausgeredet wird durch Leistungsdruck und Konkurrenzkampf.
Arno Gruen
Ich hatte das große Glück mit Arno Gruen befreundet zu sein, dessen Gedanken mich sehr beeindruckt haben. Er hat mir erzählt, wie sehr die Wissenschaftler im Neoliberalismus versuchen, das Empathische des Menschen wegzudrängen. Um ihr radikal kapitalistisches Weltbild zu stützen, brauchen sie natürlich die neo-darwinistische Ansicht, dass der Mensch eigentlich des Menschen Feind ist. Dass er immer wieder versuchen wird, sich gegenüber den anderen zu behaupten, um besser zu sein als sie. Doch diese gnadenlose Leistungsgesellschaft verbittert die Menschen, macht sie letztendlich einsam und unglücklich.
Zu Darwins Lehre hat übrigens der renommierte Hirnforscher Gerhard Hüther ein sehr schönes Buch geschrieben: „Die Evolution der Liebe: Was Darwin bereits ahnte und die Darwinisten nicht wahrhaben wollen“. Darin beschreibt er, wie sich Charles Darwin später von seinen eigenen dogmatischen Aussagen distanziert hat.
Dass es in der Evolution des Menschen eben nicht nur um das Grundprinzip von Konkurrenz, natürlicher Auslese und das Überleben der Besten im Kampf ums Dasein ging. Sondern dass für die Menschen die Zusammenarbeit viel entscheidender war, als der darwinistische Überlebenstrieb. Was die menschliche Gemeinschaft im Innersten zusammenhält ist schließlich nur eines: die Liebe. Wenn man in sich hinein spürt und auch an seinen eigenen Kindern erlebt, dass der Mensch im Grunde natürlich ein mitfühlendes Wesen ist, dann weiß man, dass man andere Formen des Zusammenlebens braucht, als wir sie heute haben.
Deutlich wird dieser Gedanke auch in einem der letzten Bücher von Arno Gruen mit dem Titel „Wider den Gehorsam“, ein befreiendes Plädoyer für mehr Mitmenschlichkeit und gegen die bedingungslose Unterordnung unter eine Macht. Er sagt, wer den Mut zum Ungehorsam hat, der entzieht sich nicht nur vermeintlichen Autoritäten, sondern nimmt die Menschen lebendig und mitfühlend wahr. Dagegen führt die Kultur des Gehorsams zu einer Entmenschlichung. Arno Gruen ruft dazu auf, gegen die Kultur des verschwiegenen Gehorsams zu revoltieren. Denn nur so können wir die Demokratie stärken und besser miteinander leben.

Fotograf: Thomas Karsten
Das drückt sehr gut den Kern dessen aus, was ich unter Anarchie verstehe. Wenn man das auch mal in sich erkannt hat, dann gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als sich sozial zu engagieren. Und selbst dann muss ich sagen, hat man immer noch ein schlechtes Gewissen dabei, weil man eigentlich noch viel mehr tun müsste.
Vor allem in der Position, in der wir hier in Deutschland sind. Uns allen geht es gut. Wie muss es den Flüchtlingen gehen, die keine warme Kleidung, nichts zu essen und kein Dach über dem Kopf haben? Da muss doch jeder ein schlechtes Gewissen haben, dass er selbst ein Dach über dem Kopf und ein warmes Bett hat. Man sollte in solchen Situationen nicht daran denken, ob einem die anderen die Butter vom Brot nehmen. Sondern man sollte sich fragen: Wie kann ich die Butter, die ich auf dem Brot habe, mit anderen teilen?
„Mönch und Krieger: Auf der Suche nach einer Welt, die es noch nicht gibt“ heißt ein bewegendes Buch von Ihnen, das im Frühjahr 2016 erschienen ist. Wie viel Mönch und Krieger steckt in Ihnen und was bedeutet das?
Wecker: Auf den ersten Blick scheinen „Mönch“ und „Krieger“ ein vermeintlich gegensätzliches Begriffspaar zu sein. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass die Mönche, die eher im stillen leben, ja oftmals auch die Rebellen innerhalb der Kirche waren. Es gibt ein sehr gutes Buch von Dorothee Sölle, mit dem Titel „Mystik und Widerstand“, darin zeigt sie, dass der Mystiker gar nicht anders kann als Widerständler zu sein. Die Mystiker wurden im Laufe der Jahrhunderte immer wieder von der Kirche verfolgt und sind hingerichtet worden – selbst Meister Eckhart wurde der Prozess gemacht.
Ich habe durchaus die Sehnsucht nach dem Mönchstum in mir und gleichzeitig auch die Sehnsucht nach dem Kriegerischen. Wobei „Krieger“ zunächst einmal eigenartig für einen Pazifisten klingt. Ich konnte die Vereinbarkeit von beidem sehr gut in einem Lied ausdrücken, das heißt „Wut und Zärtlichkeit“.
An die Entstehung des Liedes kann ich mich noch genau erinnern. Es war 2011 in Italien, ich war gerade auf dem Weg von meinem Haus ins Dorf, das nur ein paar Kilometer entfernt war. Ich habe den ganzen Text des Liedes auf mein Handy gesprochen – sonst hätte ich ihn vergessen. In einem Guss, ohne dass ich daran später noch etwas ändern musste. Da war mir plötzlich klar, dass Wut und Zärtlichkeit durchaus miteinander vereinbar sind in einer Person – ebenso wie Mönch und Krieger.
Einige Zeit zuvor hatte ich eine spannende Begegnung mit Bernie Glassman, einem jüdischen Zen Meister aus New York, die Christa Spannbauer vermittelt hat. Bernie ist ein sozial sehr engagierter Buddhist, der jahrelang Obdachlosen geholfen und auch mit ihnen gelebt hat. Aus den Gesprächen entstand 2011 unser gemeinsames Buch „Es geht ums Tun und nicht ums Siegen: Engagement zwischen Wut und Zärtlichkeit“.

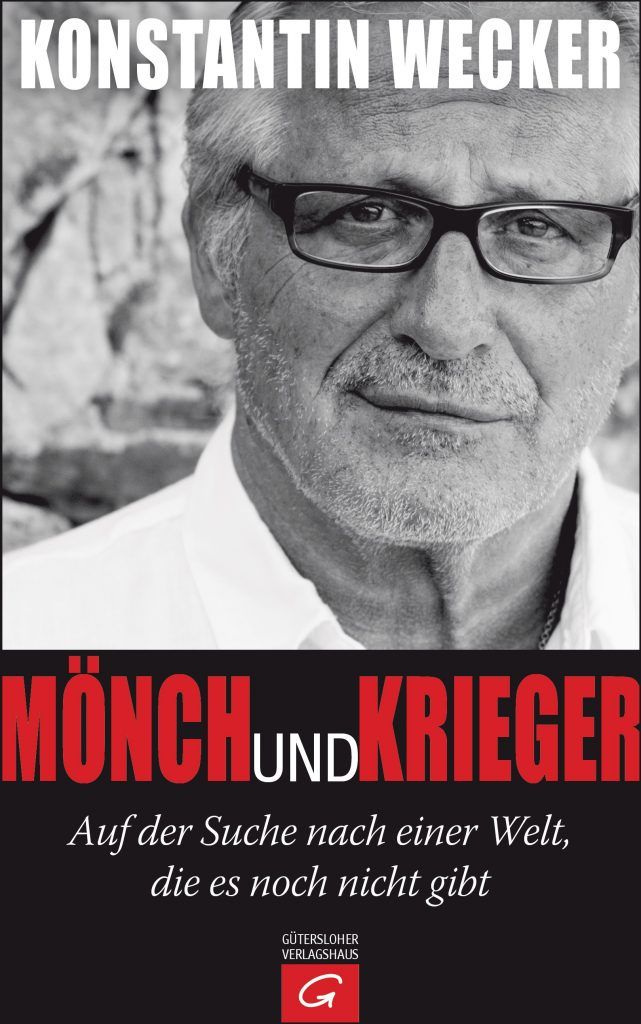
Er sagte: „Jede Hilfe von oben ist eine falsche Hilfe – die Hilfe muss von unten kommen, da wo die Menschen sind“. Das hat mich fasziniert. Bei unserem ersten Treffen in Berlin kam er gerade von einem Retreat – einem Ausflug mit Angehörigen und Nachfahren von Tätern und Opfern von Auschwitz – und war voll der Liebe. Er sagte in unserem Gespräch:
Alles muss aus der Liebe kommen und aus Liebe geschehen.
Bernard Glassman
Ich entgegnete: „ Du brauchst doch auch die Wut, um etwas zu verändern. Gerade bei deiner Arbeit mit den Obdachlosen wirst du doch oft Wut bekommen haben, angesichts der ungerechten Zustände“. Er antwortete: „Es stimmt, die Wut brauchen wir schon – aber handeln sollten wir immer aus Liebe“. Genau das meine ich mit dieser Vereinbarkeit von Mönch und Krieger.
Bis zu dem Moment, als ich das Lied „Wut und Zärtlichkeit“ geschrieben habe, dachte ich nicht, dass es zu vereinbaren sei. Ich dachte vielmehr, dass im Alter die Liebe überwiegt. Aber all die von mir sehr verehrten und großartigen alten Männer, die leider schon verstorben sind, wie Dieter Hildebrand oder Arno Gruen, waren im Alter ja auch immer noch ganz schön zornig auf die gesellschaftlichen Zustände. Doch das Handeln sollte nicht aus Zorn geschehen, sondern aus Liebe, sonst würde es weitere Ungerechtigkeiten erzeugen.
Das klingt alles sehr theoretisch, aber nehmen wir ein praktisches Beispiel: Viele Menschen engagieren sich von Herzen für Flüchtlinge, sie tun es aus Liebe, Mitgefühl und Empathie. Gleichzeitig sind sie zurecht zornig auf eine Politik, die immer ungerechter und grausamer wird und versucht, die helfenden Menschen als „Gutmenschen“ zu desavouieren. Da kann man es ganz deutlich sehen: Die Handlung und der Antrieb erfolgen aus dem Herzen heraus, aber gleichzeitig wird der Verstand zornig. Und das soll er auch! Man muss auch versuchen, politisch etwas zu bewegen.
Es geht um eine Revolution des Geistes und des Mitgefühls. Wenn wir unsere Herzen öffnen für die Widersprüche in unserer Gesellschaft kommen wir gar nicht umhin, aktiv zu werden. Jeder da, wo er sich berufen fühlt.
In „Mönch und Krieger“ haben Sie auch offen über Ihre „dunklen Seiten“ geschrieben. Warum ist es für Sie und für jeden wichtig, sich selbst zu erkennen und dabei auch seine dunklen Seiten zu erforschen?
Wecker: Der Begriff „Krieger“ schließt mit ein, dass ich auch Gewalttätiges in mir trage, wie ich es in meinem Buch beschrieben habe. Das wurde mir bei den Dreharbeiten des Filmes „Wunderkinder“ 2011 besonders bewusst, in dem es um den Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1941 in der Ukraine ging. Ich spielte einen SS-Standartenführer, der zwei jüdische Kinder in den Tod schickt, weil sie nicht perfekt genug Musik machen.
Als ich die SS-Uniform anhatte, war ich wie verwandelt. Ich bin erschrocken vor mir selbst: Ich musste den SS-Mann nicht spielen, ich war der SS-Mann. Da habe ich eine Seite in mir gefunden, die man eigentlich gar nicht wahrhaben will. Und Gott sei Dank verschwand sie auch wieder, wenn ich die Uniform ausgezogen habe.
Ich konnte dann den Satz endlich verstehen, den ein Holocaust Überlebender einmal gesagt hat: „Wer den Faschist in sich nicht entdeckt hat, der hat kein Recht, sich Anti-Faschist zu nennen“. Bei diesem Film habe ich den Faschisten in mir entdeckt. Und eben auch den Krieger. Vielleicht ist mein Bekenntnis zum Pazifismus durchaus auch ein Schutz vor meinem eigenen inneren kriegerischen Teil. Der Mensch muss sich selbst erkennen, auch seine dunklen Seiten. Am Ende seines Lebens sagte Goethe sinngemäß:
Es gibt eigentlich keine Missetat, die ich nicht auch hätte begehen können.
Johann Wolfgang von Goethe
Das sagt sehr viel aus. Auch, wie viel Glück man braucht, um bestimmte Dinge nicht zu tun, die vielleicht in einem liegen. Wenn man nicht in eine Situation gebracht wird, in dem einem das leicht gemacht wird.
Wenn man sich selbst erkannt hat, und wenigstens auch einiges von seinen dunklen Seiten weiß, dann wird man auch ein anderes Gefühl für Täter bekommen. Es ist notwendig, eine Gesellschaft vor Straftätern zu schützen, gar keine Frage. Aber man muss diese Täter trotzdem menschlich behandeln. Das ist meine felsenfeste Überzeugung.
In Europa, insbesondere in Deutschland und in den nordischen Ländern, haben wir glücklicherweise ein sehr demokratisches Gefängnissystem. In Asien, Afrika oder auch in Amerika sieht es ganz anders aus, da herrschen katastrophale Zustände. Tolstoi sagte, wenn Du wissen willst, wie ein Land beschaffen ist, dann schau dir seine Gefängnisse an.
Es ist traurig zu sehen, wie jetzt mit den rechten Populisten der Ruf nach härteren Strafen und verschärften Zuständen in den Gefängnissen wieder lauter wird. Wir haben die Verpflichtung, diese demokratischen Errungenschaften auch in unserem Rechtssystem anzuwenden. Es sollte keine Bestrafung sein, sondern Schutz. Nur so kommt man aus dem Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt heraus.
Darüber hinaus wäre es auch notwendig, die Gesellschaft vor Tätern zu schützen, die Finanzspekulationen machen und dadurch Hundert Tausende ins Elend stürzen. Doch soweit ist unsere Gesellschaft leider noch nicht.

Fotograf: Richard Föhr
Welche Rolle spielt für Sie die Meditation?
Wecker: Ich habe erst spät mit dem Meditieren angefangen, mit 50 Jahren, bei meinem zweiten Knastaufenthalt, wegen Drogenbesitz. Da war ich zwei Wochen inhaftiert und diese zwei Wochen waren sehr wichtig für mich. Weil ich spürte, dass ich endlich wieder auf mich selbst zurückgeworfen war.
Die Jahre davor hatte ich viel mit sinnlosen Party-Exzessen, Erotik und Drogen verbracht. Ich war also immer irgendwo im Außen, außerhalb meiner Selbst. Und im Gefängnis merkte ich, was mir gefehlt hat. Dann habe ich begonnen zu meditieren.
In dieser Zeit hat mir die Meditation sehr geholfen, zu mir zurückzufinden. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Meditation wirklich notwendig ist – vielleicht für manche Menschen. Natürlich kann die Meditation sehr hilfreich sein, allein um zu einer inneren Ruhe zu kommen.
Aber man kann darin keine „Gnade“ finden. Das Schöne an der Gnade ist, dass man sie weder kaufen noch erzwingen kann. Man kann vielleicht darum bitten. Aber es gibt keine Garantie, dass mir die Gnade gewährt wird, von Gott oder von wem auch immer.
Das sollten sich gerade die Menschen überlegen, die ich zur Zeit am wenigsten verstehe: Milliardäre, die der Meinung sind, sie bräuchten immer noch eine weitere Million für ihr Glück. Doch dann müssen sie erkennen, dass weder Macht noch Geld glücklich machen. Weder mit all ihrem Geld, noch mit ihrer Macht können sie sich diese Gnade erkaufen. Und das ist gut so.
Wie kam es zu Ihrem Buch „Die Kunst des Scheiterns: Tausend unmögliche Wege, das Glück zu finden“, das 2007 erschienen ist? Worin besteht für Sie die Kunst des Scheiterns?
Wecker: Vor etwa 12 Jahren kam der Verleger auf mich zu, und bat mich, eine Autobiografie zu schreiben. Ich sagte: „Ich bin zu jung dafür, das mache ich nicht“. Am nächsten Tag rief ich ihn an: „Ich habe eine Idee, ich möchte ein Buch ausschließlich über meine Niederlagen schreiben“. Da hatte ich den Titel „Die Kunst des Scheiterns“ bereits im Kopf.
Das war wahnsinnig spannend, ich habe mich ein halbes Jahr lang hingesetzt und intensiv über meine Niederlagen nachgedacht. Dann habe ich gemerkt, was mir meine Niederlagen gebracht haben, wie wertvoll diese Niederlagen für mich und mein Weiterkommen waren. Man kann auch auf einer Leiter, deren Sprossen aus Niederlagen bestehen, schön nach oben klettern.
Ein Beispiel: Als Kind hatte ich das große Glück, eine wunderbare Stimme zu haben. Es war für mich eine paradiesische Leichtigkeit, mit meinem Vater die herrlichsten italienischen Opern zu singen. Ich habe Fußball gespielt und dann habe ich La Traviata gesungen. Ich dachte damals, das kann jeder.
Doch mit dem Stimmbruch fiel ich aus dem Paradies um ein paar Oktaven tiefer in die Niederungen meiner Fleischlichkeit. Dann wusste ich, dass das nicht selbstverständlich war, sondern ein Wunder und habe mich nach dieser Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit des Singens zurückgesehnt.
Dann kamen auch die ersten intellektuellen Zweifel an den Texten der deutschen Opern. Dem habe ich auch zu verdanken, dass ich meine eigenen Texte schreiben wollte. So wurde ich schließlich zum Poeten und Liedermacher und nicht zum Opernsänger.


Ein sehr wichtiger Aspekt, der zur Kunst des Scheiterns dazugehört ist: Die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Dass man das Scheitern in Eigenverantwortlichkeit auf sich nimmt und nicht immer irgendwelche anderen Schuldigen dafür findet. Ich meine damit Schuld nicht als moralische Schuld, sondern als Ursache für etwas.
Es gibt es ein gutes Beispiel aus meinem Prozess wegen Drogenbesitzes. In der Gerichtsverhandlung habe ich gesagt, dass mein Dealer eigentlich ein guter Mensch war. Das hat den Richter empört, einen Dealer als guten Mensch zu bezeichnen. Doch schließlich wollte ich ja das Zeug von ihm. Ich hätte mich natürlich auch hinstellen und sagen können: Der böse Dealer, der hat mich süchtig gemacht, und durch ihn bin ich in diese schreckliche Situation verfallen.
Vielleicht hätte mir das Punkte im Prozess eingebracht, aber es war nicht so. Man muss irgendwann reif genug sein, die Verantwortung für sein Scheitern auf sich selbst zu nehmen. Auch, wenn andere mit daran beteiligt waren.
Später habe ich dann doch noch meine Biographie „Das ganze schrecklich schöne Leben“ – zusammen mit Günter Bauch und Roland Rottenfußer – geschrieben. Sie ist diesen Sommer zu meinem 70. Geburtstag erschienen. Sicherlich kein allzu edles Leben, und doch ein mutiges, von der Muse überreich geküsstes Leben, das viele Menschen inspiriert hat.
Herr Wecker, was ist für Sie persönlich der Sinn des Lebens?
Wecker: Diese Frage nach dem Sinn des Lebens versuche ich seit 50 Jahren in meinen Gedichten zu beantworten.
Das Interview führte Markus Hofelich.
Weitere Informationen: www.wecker.de + hinter-den-schlagzeilen.de
Bilder: Konstantin Wecker, Titelbild: Fotograf Thomas Karsten / Bücher: Gütersloher Verlagshaus, Piper Verlag, Kösel Verlag