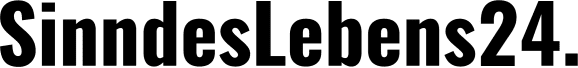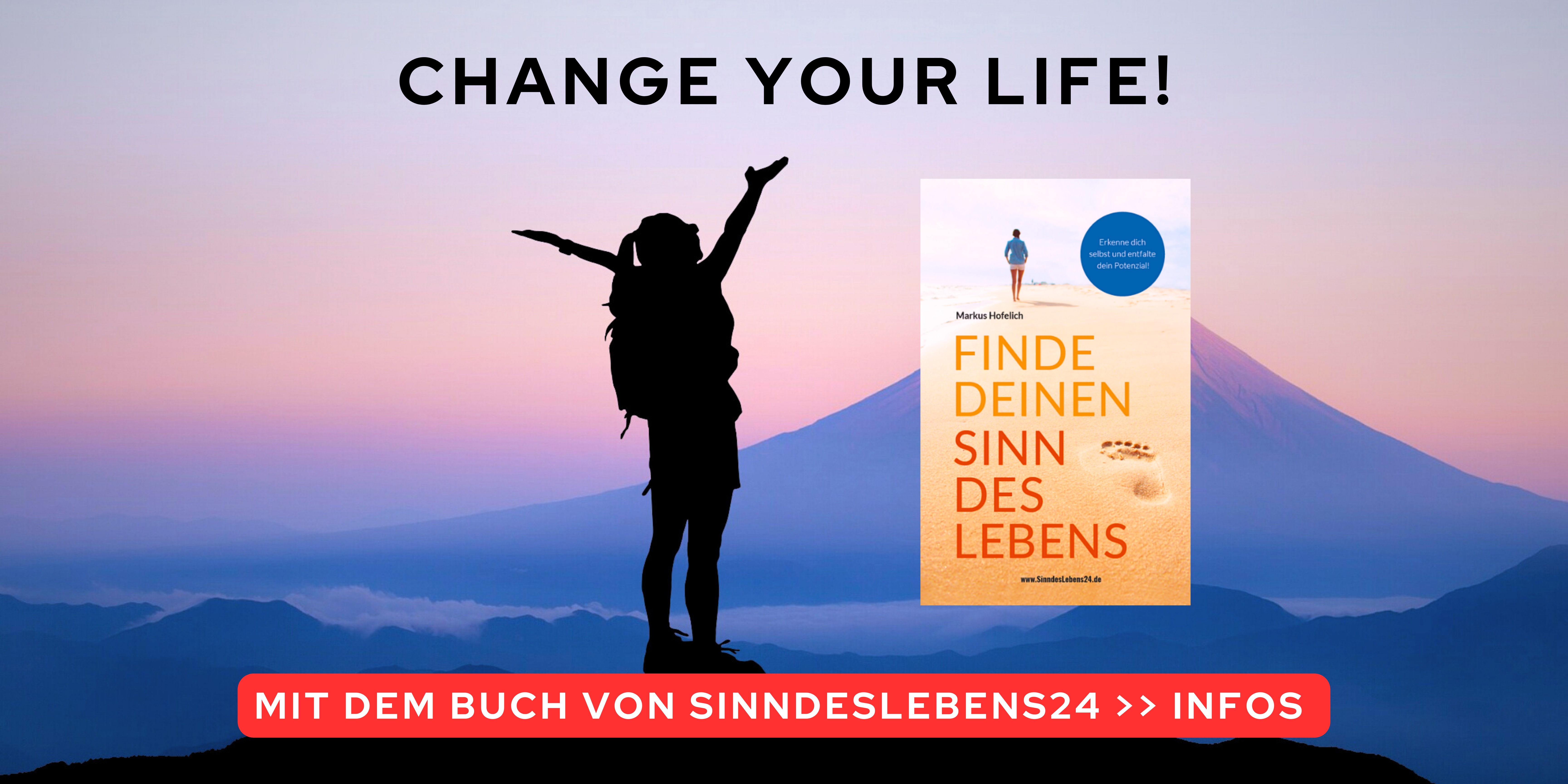Wie Menschen Mut und Glück in aussichtslosen Situationen finden und trotz aller Widerstände die Hoffnung nicht aufgeben, ist Kernthema des neuen Buches „Winter der Hoffnung“ von Peter Prange. Der historische Roman spielt im Hungerwinter 1946 und beschreibt den Überlebens-Kampf der Familie Wolf in einer aussichtslosen Zeit. Er liefert die Vorgeschichte zu seinem Bestseller „Unsere wunderbaren Jahre“, der von der ARD als Dreiteiler verfilmt wurde. Die Werke von Peter Prange wurden in 24 Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauflage von über drei Millionen erreicht. Im Interview erklärt Peter Prange, wie die Menschen es geschafft haben, trotz Leid und Entbehrung nicht aufzugeben und mit Zuversicht den Weg in eine ungewisse Zukunft wagten, was wir heute daraus lernen können und warum es so wichtig ist, niemals den Glauben an sich selbst aufzugeben.
Herr Prange, Ihr neuer Roman „Winter der Hoffnung“ spielt im Hungerwinter 1946 und beschreibt den Überlebens-Kampf der Familie Wolf in einer aussichtslosen Zeit. Worum geht es im Kern?
Prange: Es war genau diese Frage: Wie haben es die Menschen geschafft, in dieser Zeit, die kaum noch ein Überleben möglich zu machen schien, trotzdem zu überleben? Und sogar die Anfänge dazu zu legen, aus den Trümmern des größten Schurkenstaates aller Zeiten, nämlich Nazi-Deutschland, in zwei Generationen ein so lebenswertes Land zu erschaffen, wie wir es heute vorfinden.
Das ist für mich das große Wunder meiner Lebenszeit, dass die Generation meiner Eltern und Großeltern das vollbracht haben, Deutschland so von Grund auf zu verwandeln. Und wie das seinen Anfang genommen hat in der allerdunkelsten Zeit. So etwas zu vollbringen in diesem Hungerwinter 1946, wo es fast nichts mehr gab, außer dem schieren Leben, das finde ich einfach höchst erstaunlich.
– Anzeige / Datenschutz –
Wie haben es die Menschen damals vor allem psychisch geschafft, trotzdem zu überleben und auf eine positive Zukunft zu hoffen? Was waren Ihrer Meinung nach die entscheidenden Verhaltensweisen, Denkmuster und Erfolgsfaktoren dafür?
Prange: Ich bin glücklicherweise in einer Familie groß geworden, die im Gegensatz zu vielen anderen sehr offen über die Zeit des Krieges und die Nachkriegszeit gesprochen hat. Ich weiß noch einen Satz von meinem Vater, der mich schon als Kind zutiefst beeindruckt hat. Er sagte: „Wir waren dem Tod von der Schippe gesprungen, und zugleich wieder des Teufels“. Die Menschen waren so froh, aus dem herausgekommen zu sein, was sie hinter sich hatten.
Im Fall meines Vaters war das der Krieg, er ist bereits mit 17 Jahren zwangsverpflichtet worden, hat dann 4 Jahre als Soldat an der Front ums Überleben kämpfen müssen. Als der Krieg zu Ende war, hat er sich derart gefreut, davongekommen zu sein, dass ihn diese Lebenslust sogar in dieser ganz finsteren Zeit so erfüllt hat. Dass er den Blick nach vorne richten konnte, sein Leben angepackt hat und bereit war, seine Zukunft in die Hand zu nehmen.
Ich glaube das ist es, was diese Generation ausgezeichnet hat. Als sie damals, wo nach heutigen Maßstäben überhaupt nichts mehr möglich war, aus dem kleinsten und geringsten, was es überhaupt noch gab, versucht haben, etwas zu machen. Jede noch so winzige Chance ergriffen haben, um ihr Leben neu und besser zu gestalten. Allein beflügelt von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf ein weiteres Leben.
Ich glaube uns kann heute ein Blick in diese Vergangenheit auch ganz gut tun. Weil wir doch manchmal unseren Mut sinken lassen und an Problemen verzagen, die im Vergleich zu den damaligen Problemen doch eher geringfügig sind.
Hier das Interview mit Peter Prange als Podcast hören (oder auf iTunes oder Spotify / SinndesLebens24):
Viele Menschen fühlen sich heute unglücklich, obwohl es uns allen verglichen mit damals doch materiell sehr gut geht. Da lohnt auch ein Blick zurück. Was können wir heute von den Menschen von damals lernen, die in einer völlig hoffnungslosen Situation waren, vor dem absoluten Nichts standen und trotzdem an sich geglaubt haben?
Prange: Sie haben es in Ihrer Frage im Grunde schon zum Ausdruck gebracht. Entscheidend ist, den Glauben an sich selbst, den Glauben an die eigenen Fähigkeiten niemals zu verlieren. Die Menschen hatten damals im Unterschied zu heute keinerlei Unterstützung von außen.
Alles lag in Trümmern, die Gebäude, die Familien. Es gab keinen funktionierenden Staat mehr, es gab keine Hilfe von außen. Es gab nur die Chance, sich mit eigener Kraft aus dieser fatalen Situation wieder herauszuarbeiten.
Dieses zurückgeworfen werden auf sich selbst kann eben auch eine Chance sein. Nämlich die Chance, das Leben besser und neu zu gestalten, so wie man sein Leben eigentlich haben möchte. Damals hatten die Leute gar keine andere Chance, als das zu tun. Heute haben wir immer noch den Luxus, dass wir im Zweifelsfall darauf vertrauen können, dass andere uns helfen.
Manchmal frage ich mich – das mag zynisch klingen – ob es uns nicht etwas zu gut geht. Weil es uns dadurch immer möglich ist, uns auf andere zu verlassen und mit unserem Finger immer wieder auf andere Menschen oder Institutionen zu zeigen, die an unserem Unglück schuld sind.
Statt uns vielleicht selbst zu fragen, was können wir tun, damit es uns selbst und unseren Mitmenschen gemeinsam besser geht. Die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, das haben wir uns weitgehend abgewöhnt. Ich finde es ja großartig, dass wir in einem Sozialstaat leben, wo den Schwachen geholfen wird. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die sind gar nicht schwach, aber es ist halt bequem, sich helfen zu lassen.
Ich glaube jeder, der einmal dazu gezwungen worden ist, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wird auch bestätigen, dass es sehr befriedigend ist, wenn man sich selbst weiterentwickelt. Und sich nicht nur darauf verlässt, dass einem andere immer mehr unter die Arme greifen. Sondern dass man etwas aus eigener Kraft schafft.
Das ist ja auch ein zutiefst beglückendes Gefühl. Es gibt in der Anthropologie etwas, dass wir Funktionslust nennen. Die Lust daran, etwas zu schaffen. Und das ist uns sozusagen einprogrammiert worden, anders wären wir evolutionstechnisch gar nicht lebensfähig gewesen. Und diese Funktionslust verkümmert immer mehr in uns selbst. Weil uns viel zu viele Funktionen von außen abgenommen werden.
Dass wir gar nicht darauf angewiesen sind, unser eigenes Funktionieren auszuprobieren und zu erfahren, wie weit uns das trägt. Es soll wirklich nicht zynisch klingen, aber damals hatten die Menschen gar keine andere Möglichkeit als auf ihr eigenes Funktionieren zu vertrauen. Sie haben dann erlebt, wie weit das führen kann.
Mein Vater hat mir immer erzählt: „In meinem ganzen Leben habe ich nie so viel gearbeitet wie damals, aber ich habe auch nie so viel Freude gehabt. Wir haben gearbeitet, bis uns das Blut unter den Nägeln hervor spritzte. Aber wir haben dann abends gefeiert, wie wir es später nie wieder so getan haben.
Weil wir glücklich waren über jeden Schritt, den wir in Richtung Zukunft gemacht haben. Über jede noch so winzige Kleinigkeit, mit der wir unser Leben verbessern konnten. Manchmal haben wir die Nacht durchgefeiert und am nächsten Tag wieder angefangen zu arbeiten. Das ging ineinander über.“
Das heißt, im Erfahren der eigenen Tüchtigkeit, im Zuge dessen, was man zu tun imstande ist, entwickelt sich auch eine solche Lebenslust, aus der heraus die Menschen ihre Kraft schöpfen, über sich selbst hinauszuwachsen. Das ist etwas, dass bei uns heute doch etwas verkümmert ist.
An welchen Protagonisten macht sich der unbeugsame Überlebenswille am besten deutlich? Können Sie ein, zwei Beispiele nennen? Und gibt es dazu reale Vorbilder aus Ihrer Familie?
Prange: Ich bleibe zunächst bei meinem Vater, weil das zeigt sehr deutlich, was ich sagen will. In „Winter der Hoffnung“ gibt es den Tommy als den männlichen Protagonisten und der macht Tanzkurse. Die Tanzkurse hat sich mein Vater einfallen lassen, diese Figur des Tommy ist ganz dicht an meinem Vater. Mein Vater kam mit 21 Jahren aus dem Krieg zurück. Er war der älteste Überlebende von den Söhnen und deshalb war es seine Pflicht, seine Geschwister und seine Eltern materiell zu versorgen.
Wie sollte er das denn machen? Er hatte ja nichts gelernt, eine Volksschulbildung, eine abgebrochene Lehre als Schuhverkäufer, sonst nichts. Wie sollte dieser Mensch jetzt auf einmal seine Geschwister durchbringen? Aber mein Vater hat sich etwas einfallen lassen, Not macht erfinderisch.
Er, der gar nicht tanzen konnte, ist über die sauerländer Dörfer gezogen und hat den Bauernjungen das, was er sich unter Tanzen vorgestellt hatte, beigebracht. Dafür hat er dann Lebensmittel bekommen, sogenannte Fressalien, also Kartoffeln, Zwiebeln und wenn er Glück hatte etwas Speck und Wurst. Und so hat er es geschafft, seine Familie zu ernähren.
Das ist das, was ich meine. Aus den geringsten Chancen, die das Leben noch übrig lässt, ein Optimum herauszuholen, das haben diese Menschen damals gemacht. Das Beispiel meines Vaters zeigt, dass es dafür nur etwas Witz braucht, um so etwas hinzukriegen.
Schauplatz der Geschichte ist Ihre Heimatstadt Altena, ein kleines Industriestädtchen zwischen Sauerland und Ruhrgebiet. Wie viel Autobiografisches insbesondere auch aus dem Leben ihrer Eltern floss mit ein?
Prange: Ganz viel. Die meisten Figuren sind angelehnt an real existierende Vorbilder, die stammen alle aus meinem Roman „Unsere wunderbaren Jahre“. Schon da habe ich die Lebensgeschichte von nahen Angehörigen, Verwandten und Freunden meiner Eltern nachgebildet.
Beispielsweise die Figur des Benno, der wirklich nichts anderes gelernt hatte als Volksschule, als kleiner Schuhverkäufer anfing und dann im Laufe der Jahrzehnte ein Schuhhandelsunternehmen mit über 100 Schuhgeschäften aufgebaut hat. Das ist die Geschichte meines Onkels Gerd, der dieses Imperium aus dem Boden gestampft hat, eine klassische Wirtschaftswundergeschichte.
Oder die Figur der Ruth, die ist meiner Tante Hilde nachgebildet, die ein wirkliches Hiobs-Schicksal hatte. Alle Schrecken, die es nur geben kann, sind ihr widerfahren. Unter anderem war sie im Krieg verheiratet mit einem Wehrmachtssoldaten und wurde schwanger. Der Soldat ist nach ein paar Jahren in russischer Gefangenschaft wieder nach Hause gekommen und während der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind wachte sie eines Morgens auf und stellte fest, dass der Mann neben ihr tot ist.
Das war nur der Anfang einer ganzen Kette von Schicksalsschlägen, die sie verkraften musste. Aber sie hat es immer wieder geschafft, sich neu aufzurappeln, nie den Lebensmut verloren, nie den Glauben an sich selbst und nie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Ich habe versucht, diese Menschen nachzuzeichnen, aus ihrem Inneren heraus. Nicht aus einer Ideologie heraus, nach dem Motto so soll man leben, sondern aus dem Leben heraus. Aus den Blickwinkeln des gelebten Augenblicks heraus habe ich versucht nachzuempfinden, wie diese Menschen vor dem Nichts standen. Aber sich nicht mit dem Nichts begnügt, sondern versucht haben, daraus ein eigenes Leben zu machen. Das ist glaube ich einigermaßen authentisch, weil es dem realen Leben nachgezeichnet ist.
Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, sich mit der Geschichte unserer unmittelbaren Vorfahren, also Eltern und Großeltern auseinanderzusetzen?
Prange: Ich glaube, das ist nicht zwingend erforderlich. Man kann auch so tun, als wäre die eigene Geburt die Stunde null der Menschheit. Aber ich kann es gar nicht verstehen, sich nicht dafür zu interessieren. Man möchte doch wissen, wo man her kommt, ein Gespür dafür haben, auf welchen Gleisen man sitzt. Und welche Richtung das Leben schon eingeschlagen hat, bevor man überhaupt zur Welt gekommen ist.
Für mich als kleiner Junge ist es immer am schönsten gewesen, wenn ich Sonntag morgens zu meinem Vater ins Bett gekrabbelt bin und er mir von früher erzählt hat. Das hat mein Vater dann auch getan, das waren die glücklichsten Stunden. Da hat er mir von der Stadt in der ich lebte erzählt. Ich bin 1955 geboren, zehn Jahre früher hat alles völlig anders ausgesehen.
Das hat mich immer fasziniert. Wie kann mir eine Welt, die mir so vertraut ist, gleichzeitig so fremd sein? Wenn ich erfahre, dass der Eismann, der immer so freundlich ist, ein sogenannter Goldfasan war, also ein Nazi-Bonze, der in der ganzen Nachbarschaft die Leute denunziert hat.
Der Stadtbezirk, in dem ich aufgewachsen bin, hatte den schönen Namen „die Freiheit“. Wie man in „der Freiheit“ in der Nazi-Zeit gelebt hat, das hat mich immer mit einer schaurigen Faszination erfüllt. Und dieser Kontrast zu meinem behüteten Aufwachsen im Elternhaus hat mich das dreifach genießen lassen. Das ist so, wie wenn es draußen prasselt und hagelt und man sitzt im Warmen und trinkt eine Tasse Tee.
Ich glaube das kann uns allen ganz gut tun, wenn wir diesen Blick mal zurückwerfen und schauen, aus welch ärmlichen Verhältnissen dieses Deutschland in nur 2 Generationen entstanden ist. Wo es fast gar nichts gab, wo ein Stückchen Brot oder ein Mantel etwas wertvolles war, ein Stück Schokolade etwas ganz außergewöhnliches gewesen ist.
Wenn wir uns das anschauen, kann uns das etwas bewusster machen, in was für vergleichsweise paradiesischen Zeiten wir heute leben. Was für ein schönes Leben wir führen dürfen, in Freiheit, in Frieden und bei ständig steigendem Wohlstand.
Wie haben Sie Ihren Zugang zur Literatur gefunden?
Prange: Gelesen habe ich immer schon sehr gerne. Meine Eltern und Großeltern waren zwar nicht gebildet, aber sehr an Literatur interessiert und die besten Kunden in der Stadtbibliothek. Mit 8 Jahren habe ich Karl May gelesen und mit 12 habe ich mich durch das Bücherregal meiner Eltern durchgearbeitet. Da habe ich eines Tages ein Buch entdeckt, das mir wahnsinnig gut gefiel, die Buddenbrooks von Thomas Mann.
Gott sei Dank bin ich nicht in einem Haushalt des Bildungsbürgertums aufgewachsen, denn dort wäre mir gesagt worden, das ist noch nichts für Dich. So habe ich Literatur auf eine ganz elementare Weise kennengelernt, in Form von guten Geschichten, die mich entweder interessiert haben oder nicht, völlig unbefangen und naiv. Während des Studiums der Romanistik, Germanistik und Philosophie habe ich auch angefangen zu schreiben.
Ich hatte aber bald das Gefühl, dass ich der Welt nichts mitzuteilen hatte. Ich habe dann angefangen Bücher zu übersetzen und das in meiner Promotionszeit ausgebaut. Als mich Verleger fragten, willst Du nicht mal selbst etwas schreiben, da habe ich immer gesagt, ich habe der Welt nichts mitzuteilen, ich übersetze lieber gute Bücher, als dass ich schlechte schreibe.
– Anzeige / Datenschutz –
Wie haben Sie Ihre Leidenschaft für historische Romane entdeckt? Wie kam es zum Durchbruch?
Prange: Aber dann hat es ein Erweckungserlebnis bei mir gegeben, ich kann auf die Minute genau sagen, wann ich zum Schriftsteller wurde. Nämlich am 19. August 1989 um 21:45. Da machte das „Heute Journal“ mit den Bildern auf von den DDR Bürgern, die in Ungarn durch den Zaun gedrängt sind. Ich wusste in dieser Sekunde, das ist das Ende einer Epoche. Der Zaun war die Karikatur des Eisernen Vorhangs.
Ich hatte in der Sekunde die Vision von einer Geschichte, von einer Familie, die gegen Kriegsende zu einer Hochzeit zusammenkommt. Und dann schlägt die Faust Gottes in Gestalt des Kriegsendes in diese Familie hinein, versprengt die Mitglieder über ganz Deutschland. Schließlich brauchen sie dann 50 Jahre, um wieder zusammen zu finden. Also die Geschichte des geteilten und wiedervereinigten Deutschland am Beispiel einer Familie. Das war der Grundstein zu meinem Roman „Das Bernstein-Amulett“.
Ich habe erst versucht, diese Grundidee zu unterdrücken, weil ich davon überzeugt war, dass ich nicht zum Schriftsteller geboren bin. Aber diese Geschichte hat mich dann über Jahre verfolgt, bis ich gemerkt hatte: Wenn ich diese Geschichte nicht schreibe, dann werde ich als älterer Mann mal auf mein Leben zurückschauen und sagen: „Da hast du gekniffen an einer Stelle, wo dir der liebe Gott einen Fingerzeig gegeben hat. Du hättest es wenigstens ausprobieren müssen“.
Da habe ich mir gesagt, das will ich nicht erleben und habe mir ein Jahr Auszeit gegönnt und diesen Roman geschrieben. Ich hatte dann das große Glück, dass „Das Bernstein-Amulett“ von der Filmproduzentin Regina Ziegler entdeckt wurde. Sie hat ihn als Zweiteiler für die ARD verfilmt und daraufhin ist das Buch sehr erfolgreich gewesen. So wurde ich dann zum Schriftsteller, obwohl ich das eigentlich nie hatte werden wollen.
Faszinierend, dass sich die Berufung auch gegen den eigenen Willen sich Bahn bricht und durchkommt. Was empfehlen Sie Menschen, die Ähnliches empfinden?
Prange: Ja das war so und da möchte ich auch andere Menschen dazu ermutigen, die spüren, dass sich eine Idee in ihnen gar nicht unterdrücken lässt. Ich habe ja sozusagen mit dem Holzhammer auf diese Idee hinauf gehauen, damit die mich endlich in Ruhe lässt. Ich hatte damals ganz andere Sachen gemacht. Wir hatten eine kleine Familie, und ich musste doch Geld verdienen und deswegen habe ich gesagt: „Stille, ich will davon gar nichts wissen!“.
Aber diese Idee ließ sich nicht unterdrücken. Wenn die Idee so stark ist, dass sie sich über Jahre hinweg immer wieder in einem regt, dann muss man auch mal den Mut haben zu sagen:
- Ja, jetzt vertraue ich auch mal auf die Kraft meiner eigenen Idee!
- Ja, ich versuche das jetzt umzusetzen!
- Ja, ich knie mich da jetzt ein Jahr lang mit allem was mir zu Gebote steht hinein und dann kann das eben auch aufgehen und das Leben eine ganz neue Form annehmen.
Also auch hier wieder diese ursprüngliche Krisensituation, dieses Zweifeln an sich selbst, nicht an sich glauben. Nein, irgendwann muss man auch sagen: Ich glaube an mich, ich glaube an die Kraft meiner Ideen und ich mache es! Daraus bezieht man dann auch so viel Energie, dass man die Dinge wirklich schafft, weil sie aus dem Herzen kommen.
Was ist für Sie persönlich der Sinn des Lebens?
Prange: Es gibt keinen vorgegebenen Sinn des Lebens. Der einzige Sinn des Lebens besteht für jeden Einzelnen darin, dass er sich seinen eigenen Sinn erschaffen muss. Und das kann ich als Autor natürlich in besonderer Weise. Ich gestalte ja ganze Welten, da bin ich ja ein bisschen wie der liebe Gott. Denn der Autor ist in einem Buch allgegenwärtig, aber unsichtbar. Dasselbe wie der liebe Gott in der Welt.
Und so versuche ich mir und meiner Existenz Sinn zu verleihen, indem ich versuche, die Sinnhaftigkeit von Geschichten darzustellen, um daraus selber etwas zu lernen. Wenn die Menschen, die diese Geschichten lesen, darin vielleicht auch einen Sinn erkennen können, und dieser in irgendeiner Weise auch ihr eigenes Leben bereichern kann, dann ist die Plackerei nicht ganz vergebens gewesen.
Das Interview führte Markus Hofelich.
Weitere Informationen unter: www.peterprange.de
Bilder: Peter Prange / Gaby Gerster / Rieke Penninger
– Anzeige / Datenschutz –